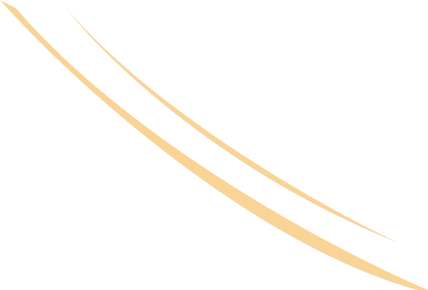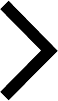Krankenvollversicherung
Private Krankenvollversicherung

Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) basiert die PKV auf dem Kapitaldeckungsverfahren, bei dem die Beiträge individuell kalkuliert werden und nicht vom Einkommen abhängen.
Die Besonderheit der PKV liegt in der Vertragsfreiheit und den oft umfangreicheren Leistungen. Versicherte können ihren Tarif selbst wählen und somit den Leistungsumfang (z.B. Chefarztbehandlung, Einzelzimmer im Krankenhaus, alternative Heilmethoden) an ihre Bedürfnisse anpassen. Ein weiterer Vorteil ist der oft schnellere Zugang zu Fachärzten und kürze Wartezeiten. Zudem bilden die Versicherer Altersrückstellungen, was bedeutet, dass ein Teil der heutigen Beiträge für zukünftige, im Alter höhere Gesundheitskosten angespart wird.
Voraussetzungen für den Abschluss einer privaten Krankenvollversicherung sind:
Selbstständigkeit: Selbstständige und Freiberufler können sich immer privat versichern.
Arbeitnehmer mit hohem Einkommen: Arbeitnehmer müssen die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) überschreiten (für 2025 voraussichtlich über 69.300 Euro brutto jährlich).
Beamte: Beamte haben einen Beihilfeanspruch vom Staat und versichern den verbleibenden Teil über die PKV.
Studenten: Studenten können sich unter bestimmten Voraussetzungen privat versichern.
Ärzte: Ärzte können sich ebenfalls privat versichern.
Ein Wechsel von der GKV in die PKV ist nicht immer möglich und sollte gut überlegt sein, da eine Rückkehr in die GKV oft nur unter bestimmten, strengen Voraussetzungen möglich ist.
Die Kosten und die Versicherbarkeit von Kindern in der privaten Krankenvollversicherung (PKV) hängen stark von der Konstellation der Eltern und dem jeweiligen Tarif ab. Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gibt es in der PKV keine beitragsfreie Familienversicherung. Jedes Kind benötigt einen eigenen Versicherungsvertrag, was zusätzliche Kosten verursacht.
Kosten der Kinderversicherung in der PKV
Die Beiträge für Kinder in der PKV sind in der Regel deutlich niedriger als für Erwachsene. Das liegt daran, dass Kinder statistisch gesehen weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen und bis zum 21. Lebensjahr in der Regel noch keine Altersrückstellungen gebildet werden.
Durchschnittliche Beiträge: Die monatlichen Beiträge für Kinder in der PKV liegen meist zwischen 80 und 200 Euro, können je nach Leistungsumfang des Tarifs und Anbieter aber auch ab etwa 50 Eurobeginnen oder in umfangreichen Tarifen auch über 300 Euro liegen.
Keine Familienversicherung: Es ist wichtig zu verstehen, dass für jedes Kind ein separater Beitrag fällig wird. Haben Sie also mehrere Kinder, multiplizieren sich diese Kosten entsprechend.
Leistungsumfang: Die Höhe des Beitrags hängt maßgeblich vom gewählten Leistungsumfang ab. Tarife mit Chefarztbehandlung, Einzelzimmer, umfassenden Leistungen für alternative Heilmethoden oder Kieferorthopädie sind teurer.
Gesundheitszustand: Vor dem Abschluss einer PKV für ein Kind erfolgt eine Gesundheitsprüfung. Vorerkrankungen können zu Risikozuschlägen oder Leistungsausschlüssen führen.
Versicherbarkeit von Kindern nach Elterngruppe
Kinder von Selbstständigen:
Versicherbarkeit: Wenn beide Elternteile privat versichert sind, müssen die Kinder ebenfalls privat versichert werden. Eine beitragsfreie Familienversicherung in der GKV ist in diesem Fall nicht möglich.
Kosten: Selbstständige tragen die vollen Beiträge für ihre Kinder selbst, da es hier keinen Arbeitgeberzuschuss gibt.
Kinder von Arbeitnehmern:
Voraussetzungen der Eltern: Ein Arbeitnehmer kann sich und somit auch seine Kinder nur privat versichern, wenn sein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)überschreitet. Für 2025 liegt die allgemeine JAEG bei 73.800 Euro brutto jährlich. Es gibt auch eine besondere JAEG für Personen, die bereits am 31.12.2002 privat versichert waren (2025: 66.150 Euro).
Versicherbarkeit der Kinder:
Ein Elternteil GKV, ein Elternteil PKV: Ist der höherverdienende Elternteil privat versichert und der geringer verdienende oder nicht erwerbstätige Elternteil gesetzlich versichert, kann das Kind in der Regel kostenfrei in der GKV familienversichert werden. Dies ist oft die bevorzugte Option, da keine zusätzlichen Beiträge anfallen.
Beide Elternteile PKV: Sind beide Elternteile privat versichert, müssen die Kinder ebenfalls privat versichert werden.
Arbeitgeberzuschuss: Der Arbeitgeber des privat versicherten Elternteils zahlt zwar einen Zuschuss zum PKV-Beitrag des Elternteils, aber keinen gesonderten Zuschuss für die private Krankenversicherung der Kinder. Die Kosten für die Kinder müssen von den Eltern selbst getragen werden.
Kinder von Beamten:
Versicherbarkeit: Beamte haben in der Regel einen Beihilfeanspruch ihres Dienstherrn (Staat). Dieser Beihilfeanspruch erstreckt sich auch auf ihre Kinder und deckt einen Großteil der Krankheitskosten ab (meist 80%, in Sachsen sogar 90%). Für den verbleibenden Anteil (z.B. 20%) wird eine private Restkostenversicherung (sogenannter „Beihilfetarif“) abgeschlossen.
Kosten: Die Beiträge für Kinder von Beamten sind aufgrund des hohen Beihilfeanspruchs deutlich geringer als in Volltarifen und liegen oft zwischen 35 und 80 Euro monatlich. Dies macht die private Krankenversicherung für Beamtenkinder in den meisten Fällen attraktiver als eine freiwillige Mitgliedschaft in der GKV, die monatlich ca. 220-230 Euro pro Kind kosten würde.
Kinder von Studenten:
Versicherbarkeit: Studenten können sich unter bestimmten Voraussetzungen von der gesetzlichen Krankenversicherung befreien lassen und sich privat versichern. Haben Studenten Kinder, müssen diese, wenn beide Elternteile privat versichert sind, ebenfalls privat versichert werden. Es gibt keine Familienversicherung wie in der GKV.
Kosten: Die Kosten für die Kinderversicherung können hier eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen, da Studierende in der Regel kein hohes Einkommen haben. BAföG-Empfänger können jedoch unter Umständen einen Zuschuss für die Kranken- und Pflegeversicherung erhalten, der auch die Kosten für die Kinder berücksichtigen kann.
Fazit: Die Entscheidung für eine private Krankenversicherung für Kinder ist komplex und sollte immer unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation, des Einkommens und der langfristigen Planung erfolgen. Die Möglichkeit der beitragsfreien Familienversicherung in der GKV ist ein wichtiger Faktor, der bei der Entscheidung zwischen GKV und PKV für Familien eine große Rolle spielt.
Zahnzusatzversicherung
Zahnzusatzversicherung

Ihr Hauptgegenstand ist die Übernahme von Kosten für zahnärztliche Behandlungen, die über die Leistungen der GKV hinausgehen und von den gesetzlichen Krankenkassen nur teilweise oder gar nicht erstattet werden. Dies betrifft insbesondere hochwertige Zahnbehandlungen und Zahnersatz.
Besonderheiten:
Ergänzung zur GKV: Die ZZV schließt die Lücke zwischen dem Kassenzuschuss und den tatsächlichen Kosten für zahnmedizinische Leistungen. Während die GKV nur eine „ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche“ Versorgung gewährleistet, ermöglicht die ZZV den Zugang zu besseren und ästhetischeren Behandlungsoptionen.
Individuelle Gestaltung: Im Gegensatz zur GKV, wo die Leistungen weitgehend standardisiert sind, bieten Zahnzusatzversicherungen eine breite Palette an Tarifen. Versicherte können den Leistungsumfang nach ihren individuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten auswählen.
Keine Pflichtversicherung: Der Abschluss einer ZZV ist freiwillig.
Wartezeiten:
Viele Zahnzusatzversicherungen sehen sogenannte Wartezeiten vor. Das bedeutet, dass nach Vertragsabschluss eine bestimmte Zeit vergehen muss, bevor Leistungen in Anspruch genommen werden können. Üblich sind:
Allgemeine Wartezeit: Oft 3 Monate für Zahnbehandlungen (z.B. Füllungen).
Besondere Wartezeit: Oft 8 Monate für Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken, Implantate) und Kieferorthopädie. Es gibt jedoch auch Tarife, die ganz auf Wartezeiten verzichten, meist sind diese aber teurer oder mit anfänglichen Summenbegrenzungen verbunden. Behandlungen, die aufgrund eines Unfalls notwendig werden, sind in der Regel von Wartezeiten ausgenommen.
Leistungsbeschränkungen:
Anfängliche Summenbegrenzungen (Zahnstaffel): Viele Tarife begrenzen die Erstattungssumme in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss. Diese Begrenzungen steigen in der Regel von Jahr zu Jahr an (z.B. 1.000 Euro im ersten Jahr, 2.000 Euro im zweiten Jahr usw.) und fallen nach einigen Jahren (oft 3 bis 5 Jahre) weg.
Angeraten oder begonnene Behandlungen: Für Behandlungen, die bereits vor Vertragsabschluss vom Zahnarzt angeraten oder sogar schon begonnen wurden, leistet die Zahnzusatzversicherung in der Regel nicht.
Ausschlüsse: Bestimmte Leistungen oder Materialien können je nach Tarif ausgeschlossen sein.
Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten:
Das Leistungsspektrum variiert stark je nach Tarif und Anbieter. Es kann umfassen:
Zahnersatz: Kronen, Brücken, Implantate, Prothesen, Inlays (Keramik, Gold). Die Erstattungsquoten können hier zwischen 50% und 100% der verbleibenden Kosten (nach Abzug der GKV-Leistung) liegen.
Zahnerhaltende Maßnahmen: Hochwertige Füllungen (z.B. Kunststoff, Keramik), Wurzelkanalbehandlungen (über die GKV-Leistung hinaus), Parodontosebehandlungen.
Zahnprophylaxe: Professionelle Zahnreinigungen (PZR), Fissurenversiegelungen, Fluoridierungen. Viele Tarife erstatten hier einen festen Betrag pro Jahr oder eine bestimmte Anzahl von Behandlungen.
Kieferorthopädie: Für Kinder und Jugendliche, manchmal auch für Erwachsene, die aus medizinischen Gründen eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.
Zusätzliche Leistungen: Laserbehandlungen, Narkoseleistungen (Lachgas, Vollnarkose) bei Angstpatienten, Funktionsanalyse, Bleaching (eher selten und oft begrenzt).
Es ist entscheidend, vor Abschluss einer Zahnzusatzversicherung die genauen Tarifbedingungen zu prüfen, um den individuellen Bedarf optimal abzudecken und unliebsame Überraschungen bei der Leistungserstattung zu vermeiden.
Krankentagegeld
Krankentagegeld

Sie leistet einen vereinbarten Geldbetrag pro Tag, für den Fall, dass der Versicherte durch eine Erkrankung oder einen Unfall arbeitsunfähig wird und dadurch Einkommenseinbußen erleidet. Sie tritt in der Regel nach Ablauf der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber bzw. nach Ablauf der gesetzlichen Krankengeldzahlung ein.
Gegenstand und Besonderheiten:
Einkommensersatz: Hauptzweck ist der Ausgleich von Einkommensverlusten bei längerer Krankheit oder Unfall. Dies ist besonders wichtig für Selbstständige, Freiberufler und Arbeitnehmer, deren gesetzliches Krankengeld nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken.
Individuelle Gestaltung: Die Höhe des Krankentagegeldes kann vom Versicherten frei gewählt werden, meist bis zur Höhe des Nettoeinkommens. Auch der Beginn der Leistung (Karenzzeit) kann flexibel festgelegt werden, z.B. ab dem 8., 15., 22. oder 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit.
Unabhängigkeit von tatsächlichen Kosten: Im Gegensatz zur Krankenvollversicherung, die Behandlungskosten erstattet, leistet das Krankentagegeld einen festen Betrag pro Tag – unabhängig davon, welche medizinischen Kosten tatsächlich anfallen.
Keine Beitragspflicht im Leistungsfall: Wenn Leistungen aus der KTG bezogen werden, entfallen in der Regel die Beitragszahlungen für die KTG selbst.
Wartezeiten:
Typischerweise gibt es allgemeine Wartezeiten von drei Monaten ab Versicherungsbeginn, bevor Leistungen im Krankheitsfall in Anspruch genommen werden können. Für bestimmte psychische Erkrankungen kann die Wartezeit auch acht Monate betragen. Diese Wartezeiten dienen dazu, zu verhindern, dass Versicherungen unmittelbar vor einem bekannten Krankheitsfall abgeschlossen werden. Bei Unfall ist die Wartezeit in der Regel aufgehoben.
Leistungsbeschränkungen:
Definition der Arbeitsunfähigkeit: Die Versicherungsbedingungen definieren genau, was als Arbeitsunfähigkeit gilt. Meist muss eine ärztliche Bescheinigung vorliegen, die die Arbeitsunfähigkeit bestätigt.
Maximale Leistungsdauer: Viele Tarife sehen eine maximale Leistungsdauer vor, z.B. 78 Wochen innerhalb von drei Jahren (angelehnt an das gesetzliche Krankengeld) oder auch unbegrenzt, solange die Arbeitsunfähigkeit besteht.
Vorerkrankungen: Bei Antragstellung müssen Vorerkrankungen angegeben werden. Diese können zu Leistungsausschlüssen oder Risikozuschlägen führen.
Ausschluss bestimmter Erkrankungen/Situationen: Oft sind Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Kur-, Rehamaßnahmen (es sei denn, die Arbeitsunfähigkeit besteht bereits vorher), Suchterkrankungen oder absichtlich selbst herbeigeführten Krankheiten/Verletzungen ausgeschlossen.
Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten:
Wie bereits erwähnt, erstattet die KTG keine Behandlungskosten. Sie ist ein reiner Einkommensersatz in Form eines Tagegeldes. Das Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten bezieht sich also auf die Auszahlung des vereinbarten Betrags. Dieser Betrag kann dann vom Versicherten für alle anfallenden Lebenshaltungskosten, Miete, Kredite etc. verwendet werden. Es gibt keine Zweckbindung für die Verwendung des ausgezahlten Betrags.
Steuerliche Behandlung im Leistungsfall:
Die erhaltenen Leistungen aus der privaten Krankentagegeldversicherung sind im Gegensatz zu beispielsweise Renten aus der Berufsunfähigkeitsversicherung steuerfrei. Das ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem regulären Einkommen. Es handelt sich um eine Einnahme, die nicht der Einkommensteuer unterliegt. Allerdings sind die Beiträge zur Krankentagegeldversicherung im Gegenzug auch nicht als Sonderausgaben in voller Höhe abzugsfähig. Sie fallen unter die Vorsorgeaufwendungen, wo es aber Höchstgrenzen gibt, die meist durch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung schon ausgeschöpft sind.
Krankenhaustagegeld
Krankenhaustagegeld

Sie gehört nicht zur Pflichtversicherung, sondern ist eine freiwillige Ergänzung, die dazu dient, finanzielle Lücken während eines Klinikaufenthalts zu schließen.
Gegenstand: Der zentrale Gegenstand der KHT ist die finanzielle Absicherung bei stationärer Krankenhausbehandlung. Sie leistet unabhängig von den tatsächlichen Kosten für die Behandlung oder den Verdienstausfall. Das ausgezahlte Tagegeld kann frei verwendet werden, beispielsweise zur Deckung von Zuzahlungen, Fahrtkosten, Kosten für die Kinderbetreuung, für private Ausgaben oder als Ausgleich für entgangenen Lohn. Es handelt sich um eine sogenannte Summenversicherung.
Besonderheiten:
Flexibilität des Tagegelds: Der Versicherungsnehmer kann die Höhe des Tagegeldes selbst bestimmen, je nach persönlichem Bedarf und gewünschter Absicherung. Eine höhere Absicherung führt zu entsprechend höheren Beiträgen.
Unabhängigkeit von der Hauptversicherung: Die KHT kann unabhängig von der privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung abgeschlossen werden. Auch GKV-Versicherte können eine KHT abschließen.
Keine Zweckbindung: Das ausgezahlte Geld muss nicht für konkrete Krankheitskosten verwendet werden.
Wartezeiten: Typischerweise gibt es bei privaten Krankenhaustagegeldversicherungen Wartezeiten. Diese betragen in der Regel:
Allgemeine Wartezeit: Oft 3 Monate für alle Leistungen.
Besondere Wartezeit: Für bestimmte Erkrankungen, wie z.B. psychische Erkrankungen, Zahnersatz oder Schwangerschaft, können längere Wartezeiten von 8 Monaten oder sogar länger gelten.
Unfälle: Bei Unfällen entfallen die Wartezeiten in der Regel.
Es gibt jedoch auch Tarife, die ganz auf Wartezeiten verzichten, meistens bei entsprechend höheren Prämien.
Leistungsbeschränkungen: Die Leistungen der KHT sind an bestimmte Bedingungen geknüpft und können beschränkt sein:
Stationärer Aufenthalt: Eine Leistung wird nur bei einem medizinisch notwendigen, stationären Krankenhausaufenthalt erbracht. Ambulante Behandlungen oder Aufenthalte in Reha-Kliniken oder Kureinrichtungen sind in der Regel ausgeschlossen, es sei denn, dies ist explizit im Tarif vereinbart.
Ausschluss bestimmter Ursachen: Krankenhausaufenthalte aufgrund von Suchterkrankungen, Schönheitsoperationen ohne medizinische Notwendigkeit oder vorsätzlich selbst herbeigeführten Erkrankungen/Verletzungen sind oft vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Maximalleistungsdauer: Viele Tarife legen eine maximale Anzahl von Tagen fest, für die pro Versicherungsjahr oder pro Versicherungsfall ein Tagegeld gezahlt wird (z.B. 365 Tage pro Jahr).
Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten: Das Spektrum der Erstattung ist im Grunde sehr einfach: Es wird der vertraglich vereinbarte Tagessatz für jeden Tag des stationären Aufenthalts im Krankenhaus ausgezahlt. Es gibt keine Erstattung von Rechnungen oder Kosten, sondern eine pauschale Auszahlung.
Standardleistung: Auszahlung des vereinbarten Tagegelds.
Zusätzliche Leistungen (optional): Einige Tarife bieten die Möglichkeit, Zusatzleistungen zu versichern, wie z.B. ein erhöhtes Tagegeld bei Intensivstationsaufenthalt oder eine Einmalleistung bei besonders langen Krankenhausaufenthalten.
Erhöhung im Alter: Manche Tarife bieten die Möglichkeit, das Tagegeld im Alter automatisch zu erhöhen, um einer Inflation oder steigenden Ausgaben entgegenzuwirken.
Zusammenfassend bietet die KHT eine flexible und sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Krankenversicherung, um finanzielle Engpässe während eines Krankenhausaufenthalts abzufedern, deren Besonderheit in der pauschalen und zweckungebundenen Auszahlung des vereinbarten Tagessatzes liegt.
Alternative Heilmethoden
Alternative Heilmethoden

Die Übernahme der Kosten für solche Behandlungen ist in Deutschland komplex und hängt stark von der Art der Krankenversicherung (gesetzlich oder privat) und dem gewählten Tarif ab.
Gegenstand der Versicherung Alternativer Heilmethoden
Der Gegenstand der Versicherung Alternativer Heilmethoden ist die Kostenübernahme für Behandlungen, die nicht primär der schulmedizinischen Lehrmeinung entsprechen, aber von Patienten nachgefragt werden. Hierzu zählen eine Vielzahl von Therapien, darunter:
Homöopathie: Behandlung mit hochverdünnten Substanzen.
Osteopathie: Manuelle Therapie zur Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen im Körper.
Akupunktur: Einstechen von Nadeln in bestimmte Punkte des Körpers zur Linderung von Schmerzen und zur Behandlung von Krankheiten.
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM): Umfasst Akupunktur, Kräuterheilkunde, Ernährungslehre, Qigong und Tuina.
Phytotherapie: Behandlung mit pflanzlichen Mitteln.
Chiropraktik: Manuelle Behandlung von Funktionsstörungen an Gelenken, insbesondere der Wirbelsäule.
Naturheilverfahren nach Kneipp, Schüßler-Salze, Bachblüten, etc.
Besonderheiten der Versicherung Alternativer Heilmethoden
Die Besonderheiten dieser Versicherungsoptionen liegen in ihrer vielfältigen Ausgestaltung und den unterschiedlichen Erstattungsmodalitäten:
Private Krankenversicherung (PKV) und private Zusatzversicherungen: In der PKV sind Leistungen für alternative Heilmethoden oft in den Tarifen enthalten oder können über spezielle Zusatztarife versichert werden. Der Umfang der Erstattung ist hier meist großzügiger als in der GKV. Private Zusatzversicherungen sind auch für gesetzlich Versicherte eine Option, um Leistungen für Naturheilverfahren abzudecken.
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV): Die GKV übernimmt alternative Heilmethoden in der Regel nur eingeschränkt. Einige Kassen bieten im Rahmen von Satzungsleistungen oder speziellen Wahltarifen Zuschüsse für bestimmte Therapien (z.B. Osteopathie mit ärztlicher Verordnung, Akupunktur bei chronischen Schmerzen). Ein Großteil der Kosten muss jedoch oft selbst getragen werden.
Wartezeiten: Bei privaten Zusatzversicherungen für alternative Heilmethoden gibt es oft Wartezeiten. Eine allgemeine Wartezeit beträgt üblicherweise 3 Monate, bevor Leistungen in Anspruch genommen werden können. Für besondere Leistungen wie Entbindung oder Psychotherapie kann die Wartezeit auch 8 Monate betragen. Es gibt jedoch auch Tarife, die auf Wartezeiten verzichten, wobei Leistungen für bereits begonnene oder angeratene Behandlungen in der Regel ausgeschlossen sind.
Leistungsbeschränkungen: Leistungsbeschränkungen sind bei Versicherungen für alternative Heilmethoden weit verbreitet. Diese können sich äußern in:
Jährlichen Höchstgrenzen: Viele Tarife decken die Kosten nur bis zu einem bestimmten Maximalbetrag pro Jahr (z.B. 500 Euro, 1000 Euro oder mehr).
Prozentualen Erstattungen: Oft werden nur 70%, 80% oder 90% der Kosten erstattet, der Rest ist als Eigenanteil zu tragen.
Ausschluss bestimmter Methoden: Nicht alle alternativen Heilmethoden sind in jedem Tarif enthalten. Es ist wichtig, die Tarifbedingungen genau zu prüfen.
Vorgabe des Behandlers: Manche Versicherungen erstatten nur Behandlungen durch Ärzte mit entsprechender Zusatzbezeichnung oder anerkannte Heilpraktiker.
Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten: Das Spektrum reicht von der vollständigen Übernahme bei bestimmten, oft medizinisch notwendigen Akupunkturbehandlungen in der GKV bis hin zu umfassenden Paketen in der PKV, die eine Vielzahl von Therapien und auch die Kosten für Naturarzneimittel abdecken. Es ist entscheidend, den konkreten Tarif und seine Leistungsinhalte zu prüfen.
Hufelandverzeichnis: Das Hufelandverzeichnis (vollständiger Name: Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen Therapierichtungen) ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Erstattung alternativer Heilmethoden, insbesondere im Bereich der privaten Krankenversicherungen und Zusatzversicherungen. Es handelt sich um eine Sammlung bewährter und wirksamer Naturheilverfahren, die von der Hufelandgesellschaft für Gesamtmedizin e.V. herausgegeben wird. Es listet Verfahren auf, die von naturheilkundlich tätigen Ärzten und Heilpraktikern angewendet werden, und dient Versicherern als Orientierungshilfe für die Kostenübernahme. Viele Tarife knüpfen ihre Erstattungsfähigkeit an die Aufnahme einer Methode in dieses Verzeichnis oder an das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Versicherung alternativer Heilmethoden einen wichtigen Bereich der Gesundheitsvorsorge darstellt, der jedoch eine genaue Prüfung der jeweiligen Versicherungsbedingungen erfordert, um Enttäuschungen bei der Kostenerstattung zu vermeiden.
Sehen und Hören
Sehen und Hören

Gegenstand der Versicherung:
Der Hauptgegenstand dieser Versicherungen ist die finanzielle Absicherung bei Neuanschaffung, Reparatur oder Ersatz von Brillen (inkl. Gestell, Gläser, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen mit Sehstärke) und Hörgeräten (inkl. Zubehör). Oft werden diese als Zusatzbausteine zu einer bestehenden Krankenversicherung (privat oder gesetzlich) angeboten oder als eigenständige Zusatzversicherung. Einige Tarife decken auch Augenlaser-Operationen (LASIK, LASEK) oder augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen ab.
Besonderheiten:
Ergänzung zur GKV: Während die GKV lediglich eine „Regelversorgung“ für Brillen (oft nur bei starker Sehschwäche oder bestimmten Indikationen) und einen Festbetrag für Hörgeräte (alle sechs Jahre) übernimmt, schließen Zusatzversicherungen die Lücke zu höherwertigen oder häufigeren Neuanschaffungen.
Schutz vor unvorhergesehenen Kosten: Neben der Neuanschaffung bei geänderter Sehstärke oder Hörleistung decken viele Tarife auch Schäden durch Bruch, Beschädigung, Zerstörung, Diebstahl oder sogar Verlust ab. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da die GKV hier in der Regel nicht leistet.
Flexibilität und Wahlfreiheit: Versicherte haben oft die Freiheit, den Optiker oder Akustiker ihrer Wahl aufzusuchen und hochwertige Modelle zu wählen, die über die Basisversorgung hinausgehen.
Individuelle Prämien: Die Beiträge variieren je nach Leistungsumfang, Alter des Versicherten und gewählter Versicherungssumme.
Wartezeiten:
Viele Brillen- und Hörgeräteversicherungen sehen Wartezeiten vor, bevor Leistungen in Anspruch genommen werden können. Diese liegen oft zwischen 3 und 8 Monaten für allgemeine Behandlungen und können für aufwendigere Leistungen wie Augenlaser-Operationen auch 12 bis 60 Monate betragen. Es gibt jedoch auch Tarife, die auf Wartezeiten verzichten, insbesondere wenn es um die sofortige Erstattung für eine neue Sehhilfe geht. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn man kurz nach Vertragsabschluss eine neue Brille oder ein neues Hörgerät benötigt.
Leistungsbeschränkungen:
Höchstgrenzen: Die Erstattung ist fast immer auf Höchstbeträge pro Anschaffung oder pro Ohr/Auge begrenzt (z.B. 300 EUR für eine Brille alle 24 Monate, 800 EUR für ein Hörgerät alle 36 oder 60 Monate).
Zeitliche Begrenzung der Neuanschaffung: Der Anspruch auf eine neue Brille oder ein neues Hörgerät ist meist an bestimmte Zeitintervalle (z.B. alle 24 Monate für Brillen, alle 36 oder 60 Monate für Hörgeräte) oder an eine definierte Veränderung der Sehstärke (z.B. um mindestens 0,5 Dioptrien) geknüpft.
Ausschluss von Verschleiß und Verbrauchsmaterial: Kosten für den Gebrauch von Hörgeräten (z.B. Batterien) oder Pflegemittel sind in der Regel nicht versichert.
Vorerkrankungen/Bereits angeratene Behandlungen: Wie bei vielen Versicherungen sind Schäden oder die Notwendigkeit einer Neuanschaffung, die bereits vor Vertragsabschluss bekannt oder angeraten waren, oft vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten:
Das Spektrum der Erstattung ist je nach Tarif sehr unterschiedlich:
Brillen: Erstattet werden können Brillengestelle, Einstärken-, Gleitsicht- und Sonnenbrillengläser mit Sehstärke, sowie Kontaktlinsen und Pflegemittel. Die Erstattung erfolgt entweder prozentual (z.B. 80-100%) oder als fester Maximalbetrag.
Hörgeräte: Hier werden in der Regel die Kosten für das Hörgerät selbst, die Anpassung und teilweise auch Reparaturen übernommen. Auch hier gibt es prozentuale Erstattungen oder feste Höchstbeträge pro Ohr.
Augenlaser-Operationen: Einige Tarife bezuschussen Lasik- oder Lasek-Operationen zur Korrektur von Fehlsichtigkeit, oft mit einmaligen Höchstbeträgen und langen Wartezeiten.
Vorsorgeuntersuchungen: Einige umfassendere Tarife beinhalten auch Zuschüsse für augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen (z.B. Glaukom-Vorsorge, Makuladegeneration), die nicht von der GKV übernommen werden.
Sonstige Hilfsmittel: In einigen Kombi-Tarifen können auch andere medizinische Hilfsmittel wie Perücken, Insulinpumpen oder Rollstühle abgedeckt sein.
Es ist unerlässlich, die genauen Versicherungsbedingungen jedes Tarifs sorgfältig zu prüfen, um den individuellen Bedarf optimal abzudecken und unliebsame Überraschungen im Leistungsfall zu vermeiden.
Chefarzt-Behandlung
Chefarzt-Behandlung und Zwei-Bett-Zimmer

Sie geht über die Grundversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hinaus und bietet dem Versicherten zusätzlichen Komfort und individuelle Behandlungsoptionen.
Gegenstand der Absicherung:
Chefarztbehandlung (ärztliche Wahlleistungen): Dies beinhaltet die persönliche Behandlung durch den Chefarzt oder einen liquidationsberechtigten Oberarzt im Krankenhaus. Ziel ist es, von der Expertise und Erfahrung des leitenden Arztes zu profitieren. Die Abrechnung erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), wobei der Arzt für seine persönlich erbrachten Leistungen höhere Sätze (bis zum 3,5-fachen des Regelsatzes) berechnen darf, sofern er dies nachvollziehbar begründet.
Unterkunft im Ein- oder Zweibettzimmer (komfortbedingte Wahlleistungen): Statt der allgemeinen Unterbringung im Mehrbettzimmer ermöglicht diese Option eine privatere Atmosphäre und oft zusätzliche Annehmlichkeiten wie erweitertes Menü, Telefon, Internet und einen höheren Servicestandard.
Besonderheiten der Absicherung:
Vertragsfreiheit und individuelle Anpassung: Im Gegensatz zur GKV, die einen festen Leistungskatalog bietet, können Versicherte in der PKV oder mit einer Zusatzversicherung den Umfang der stationären Wahlleistungen selbst bestimmen und ihren Tarif entsprechend anpassen. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Absicherung.
Verbesserte Behandlungsqualität und Komfort: Die Wahlleistungen sind darauf ausgelegt, den Krankenhausaufenthalt angenehmer zu gestalten und eine intensivere, individuellere Betreuung zu ermöglichen.
Finanzielle Absicherung: Ohne entsprechende Absicherung müssten die Kosten für Chefarztbehandlung und Einzelzimmer komplett aus eigener Tasche gezahlt werden, was schnell hohe Summen erreichen kann.
Wartezeiten:
Viele Tarife für stationäre Wahlleistungen sehen anfängliche Wartezeiten vor. Üblich sind:
Allgemeine Wartezeit: Oft 3 Monate. Während dieser Zeit sind Leistungen für neu auftretende Krankheiten in der Regel ausgeschlossen.
Besondere Wartezeit: Für bestimmte Leistungen, wie z.B. Entbindungen oder Psychotherapie, können Wartezeiten von 8 Monaten oder länger gelten.
Unfall: Bei einem Unfall entfallen die Wartezeiten in der Regel. Einige Tarife verzichten komplett auf Wartezeiten, sind aber oft mit einer strengeren Gesundheitsprüfung verbunden oder bieten im Gegenzug nicht das gleiche Leistungsspektrum.
Leistungsbeschränkungen:
Trotz umfassender Absicherung gibt es potenzielle Leistungsbeschränkungen:
GOÄ-Höchstsätze: Obwohl die Chefarztbehandlung nach GOÄ bis zum 3,5-fachen Satz abgerechnet werden kann, gibt es in manchen Tarifen Begrenzungen auf niedrigere Faktoren (z.B. 2,3-fach oder 2,8-fach), wenn die Begründung des Arztes nicht ausreichend ist oder bestimmte Leistungen an andere Ärzte delegiert wurden.
Notwendigkeit der Behandlung: Die Erstattung setzt in der Regel eine medizinisch notwendige Behandlung voraus. Kosmetische Operationen oder nicht medizinisch indizierte Behandlungen sind üblicherweise ausgeschlossen.
Privatkliniken ohne Kassenzulassung: Nicht alle Privatkliniken sind in jedem Tarif abgedeckt. Es sollte geprüft werden, ob die gewählte Klinik vom Versicherer anerkannt wird.
Zuzahlungen/Selbstbehalte: Manche Tarife sehen einen Selbstbehalt oder eine tägliche Zuzahlung für die Wahlleistungen vor.
Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten:
Das Spektrum der Erstattungsmöglichkeiten ist je nach Tarif und Versicherungsgesellschaft sehr vielfältig:
Volle Kostenerstattung: Die besten Tarife erstatten 100% der Kosten für Chefarztbehandlung und Unterkunft im Ein- oder Zweibettzimmer, oft auch über die Höchstsätze der GOÄ hinaus, wenn dies vertraglich vereinbart ist.
Prozentuale Erstattung: Andere Tarife erstatten einen bestimmten Prozentsatz der Kosten (z.B. 80% oder 90%), sodass ein Eigenanteil verbleibt.
Krankenhaustagegeld: Einige Tarife bieten statt der direkten Kostenübernahme ein festes Krankenhaustagegeld an, das der Versicherte frei verwenden kann, um die Kosten für Wahlleistungen zu decken oder anderweitige Ausgaben zu finanzieren.
Freie Krankenhauswahl: Viele Tarife ermöglichen die freie Wahl des Krankenhauses, auch von Privatkliniken, was den Zugang zu spezialisierten Einrichtungen oder bevorzugten Ärzten erleichtert.
Erweiterte Serviceleistungen: Darüber hinaus können auch Leistungen wie die Aufnahme einer Begleitperson (Rooming-in), besondere Verpflegung oder Komfortleistungen im Zimmer (z.B. erweiterte Menüauswahl, Fernseher, Telefon) in den Tarifen enthalten sein.
Es ist ratsam, die genauen Leistungen und Bedingungen des jeweiligen Tarifs vor Abschluss sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Absicherung den individuellen Bedürfnissen und Erwartungen entspricht.
Besonderheiten: Anwartschaften
Anwartschaften in der privaten Krankenversicherung (PKV) sind eine besondere Form der Absicherung, die es ermöglicht, den Anspruch auf eine private Krankenvollversicherung zu einem späteren Zeitpunkt unter bestimmten Konditionen zu sichern, ohne eine erneute Gesundheitsprüfung durchlaufen zu müssen. Im Grunde „friert“ man damit den Gesundheitszustand und gegebenenfalls das Eintrittsalter ein.
Gegenstand der Anwartschaft: Der zentrale Gegenstand einer Anwartschaft ist die Garantie, bei einem späteren Wiedereintritt oder Neueintritt in die PKV nicht aufgrund zwischenzeitlich aufgetretener Erkrankungen oder einer Verschlechterung des Gesundheitszustands höhere Beiträge zahlen zu müssen oder gar abgelehnt zu werden. Es ist sozusagen eine „Platzhalter-Versicherung“, die in der Zwischenzeit keine Leistungen erbringt, aber das Recht auf einen späteren Vertrag sichert.
Besonderheiten der Anwartschaft:
Keine Leistungsansprüche: Während der Anwartschaftsphase erhalten Sie keine medizinischen Leistungen aus dem Vertrag. Sie müssen in dieser Zeit anderweitig krankenversichert sein (z.B. gesetzlich, durch freie Heilfürsorge, im Ausland).
Sicherung der Konditionen: Der Hauptvorteil ist die Sicherung des aktuellen Gesundheitszustands und je nach Art der Anwartschaft auch des Eintrittsalters.
Geringe Beiträge: Die Beiträge für eine Anwartschaft sind deutlich geringer als die für eine vollwertige PKV, da keine Leistungen erbracht werden.
Flexibilität: Sie ist sinnvoll in Situationen, in denen man die PKV vorübergehend verlassen muss oder möchte (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit, Auslandsaufenthalt, Wechsel in die GKV unter die JAEG) oder wenn man als Student, Beamtenanwärter oder Soldat später in die PKV eintreten möchte.
Unterschiede der Stufen der Anwartschaften:
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Anwartschaften:
Kleine Anwartschaft:
Gegenstand: Die kleine Anwartschaft sichert ausschließlich den Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Abschlusses der Anwartschaft.
Besonderheit: Bei einem späteren Übergang in die vollwertige PKV entfällt eine erneute Gesundheitsprüfung. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn sich der Gesundheitszustand in der Zwischenzeit verschlechtert hat.
Kosten: Die Beiträge sind sehr gering, da keine Altersrückstellungen gebildet werden.
Auswirkung auf Beiträge: Der spätere Beitrag für die vollwertige PKV richtet sich nach dem dann erreichten Alter des Versicherten. Das bedeutet, der Beitrag wird höher sein, als er es zu einem jüngeren Zeitpunkt gewesen wäre, da das Eintrittsalter ein wichtiger Kalkulationsfaktor ist.
Zielgruppe: Oft sinnvoll für junge Beamtenanwärter oder Zeitsoldaten, die für eine begrenzte Zeit anderweitig versichert sind, aber später in die PKV wechseln möchten und sich günstige Konditionen sichern wollen, ohne sofort hohe Beiträge zu zahlen.
Große Anwartschaft:
Gegenstand: Die große Anwartschaft sichert nicht nur den Gesundheitszustand, sondern auch das ursprüngliche Eintrittsalter des Versicherungsvertrags.
Besonderheit: Während der Laufzeit der großen Anwartschaft werden weiterhin Altersrückstellungen gebildet oder die bereits gebildeten Rückstellungen bleiben erhalten und werden nicht angetastet. Dadurch wird der Beitrag bei Wiederaufnahme der vollwertigen PKV so berechnet, als hätte der Vertrag nie geruht und das ursprüngliche Eintrittsalter bliebe erhalten. Dies führt zu erheblichen Beitragsersparnissen im Alter.
Kosten: Die Beiträge für die große Anwartschaft sind höher als die der kleinen Anwartschaft, da hier die Altersrückstellungen weitergeführt werden. Sie liegen aber immer noch deutlich unter den Beiträgen für eine vollwertige PKV.
Auswirkung auf Beiträge: Der spätere Beitrag orientiert sich am ursprünglichen Eintrittsalter, was die monatlichen Kosten im Alter deutlich reduziert.
Zielgruppe: Insbesondere für Beamte oder andere Personen, die für einen längeren Zeitraum aus der PKV ausscheiden müssen (z.B. bei Bezug freier Heilfürsorge) und sich sicher sind, dass sie später wieder in die PKV zurückkehren werden. Sie dient dazu, die langfristige Beitragsstabilität der PKV zu wahren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anwartschaften ein wertvolles Instrument in der PKV sind, um Flexibilität zu gewährleisten und sich langfristig günstige Konditionen zu sichern, insbesondere in Übergangsphasen des Lebens. Die Wahl zwischen kleiner und großer Anwartschaft hängt stark von der individuellen Lebensplanung und der gewünschten Absicherung der zukünftigen Beiträge ab.
Hilfsmitteltarife
Hilfsmitteltarife in der privaten Krankenversicherung

Der Gegenstand dieser Tarife ist die Erstattung von Aufwendungen für medizinisch notwendige Geräte und Produkte, die dazu dienen, eine Krankheit oder Behinderung auszugleichen, zu lindern, einer Verschlimmerung vorzubeugen oder eine erfolgreiche Behandlung zu unterstützen.
Typische Hilfsmittel, die in diesen Tarifen berücksichtigt werden, sind beispielsweise:
Seh- und Hörhilfen: Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte
Körperersatzstücke: Prothesen
Orthopädische Hilfsmittel: Rollstühle, Gehhilfen, Bandagen, orthopädische Schuhe
Atemtherapiegeräte: Beatmungsgeräte
Inkontinenzhilfen: Windeln, Katheter
Geräte zur Messung und Überwachung: Blutzuckermessgeräte, Insulinpumpen
Die Besonderheiten von Hilfsmitteltarifen in der PKV sind vielfältig:
Individuelle Vertragsgestaltung: Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), wo der Leistungskatalog für Hilfsmittel (Hilfsmittelverzeichnis) weitgehend standardisiert ist, können Versicherte in der PKV den Umfang der Hilfsmittelversorgung in ihrem Tarif individuell wählen. Dies ermöglicht eine Anpassung an persönliche Bedürfnisse und Präferenzen.
Offene vs. Geschlossene Hilfsmittelkataloge:
Offener Hilfsmittelkatalog: Dies ist die vorteilhafteste Variante. Hier werden alle medizinisch notwendigen Hilfsmittel erstattet, auch wenn sie nicht explizit im Katalog aufgeführt sind. Dies ist besonders wichtig für neue, innovative oder kostenintensive Hilfsmittel, die noch nicht weit verbreitet sind.
Geschlossener Hilfsmittelkatalog: Hier werden nur die explizit im Tarif genannten Hilfsmittel erstattet. Das kann dazu führen, dass moderne oder spezifische Hilfsmittel, die für den individuellen Heilungserfolg wichtig wären, nicht übernommen werden.
Qualität und Preis: PKV-Tarife ermöglichen oft die Erstattung von hochwertigeren oder technisch fortschrittlicheren Hilfsmitteln im Vergleich zur GKV, wo in der Regel nur die „einfache Ausführung“ erstattet wird. Allerdings können Tarife auch hier Einschränkungen vorsehen, z.B. durch „einfache Ausführung“ oder bestimmte Höchstgrenzen.
Erstattungshöchstgrenzen und Intervalle: Viele Tarife legen fest, bis zu welchem Höchstbetrag bestimmte Hilfsmittel (z.B. Brillen oder Hörgeräte) erstattet werden und in welchen zeitlichen Abständen (z.B. alle zwei oder drei Jahre) eine erneute Erstattung möglich ist.
Notwendigkeit der ärztlichen Verordnung: Grundsätzlich muss die medizinische Notwendigkeit eines Hilfsmittels durch eine ärztliche oder zahnärztliche Verordnung bestätigt werden. Bei teureren Anschaffungen fordern die Versicherer oft einen Kostenvoranschlag.
Miet- und Leihmodelle: Für Hilfsmittel, die nur vorübergehend benötigt werden (z.B. Gehhilfen nach einem Unfall), bieten viele PKV-Tarife auch die Erstattung von Miet- oder Leihgebühren an. Auch Kosten für Reparatur und Wartung können abgedeckt sein.
Bei der Wahl eines PKV-Tarifs ist es daher entscheidend, die Bestimmungen zu Hilfsmitteln genau zu prüfen, insbesondere ob ein offener oder geschlossener Katalog zugrunde liegt und welche Erstattungsgrenzen und Ausschlüsse eventuell bestehen.