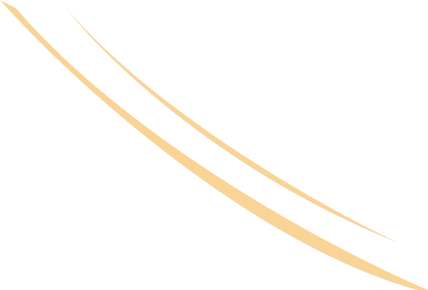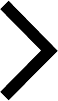LV als Altersvorsorge
LV als Altersvorsorge

Gegenstand der Lebensversicherung als Altersvorsorge
Der Hauptgegenstand der Lebensversicherung als Altersvorsorge ist der Aufbau eines Kapitals, das dem Versicherungsnehmer im Alter, meist ab Renteneintritt, als einmalige Auszahlung oder in Form einer lebenslangen Rente zur Verfügung steht. Parallel dazu bietet sie in der Regel auch eine Absicherung des Todesfallrisikos, was bedeutet, dass bei Ableben des Versicherungsnehmers vor Rentenbeginn die Angehörigen finanziell abgesichert sind.
Besonderheiten der Lebensversicherung als Altersvorsorge
Langfristigkeit: Lebensversicherungen sind auf einen sehr langen Zeitraum ausgelegt, oft über mehrere Jahrzehnte. Dies ermöglicht einen Zinseszinseffekt, der über die Jahre ein beträchtliches Kapital aufbauen kann.
Sicherheit (historisch): Traditionell galten klassische Lebensversicherungen als sehr sicheres Anlageprodukt, da die Versicherungsgesellschaften einen garantierten Zins und eine Beteiligung an Überschüssen zusicherten. Dies ist jedoch in Zeiten niedriger Zinsen zunehmend schwieriger geworden.
Kombination aus Sparen und Absicherung: Die Lebensversicherung vereint die Funktionen des Sparens und der Risikovorsorge in einem Produkt.
Steuerliche Behandlung: Beiträge zu bestimmten Formen der Lebensversicherung können unter Umständen steuerlich absetzbar sein, und die Auszahlungen im Alter können steuerbegünstigt sein, insbesondere wenn die Verträge vor 2005 abgeschlossen wurden (in Deutschland). Neue Verträge unterliegen anderen steuerlichen Regelungen.
Vertragliche Garantien: Bei klassischen Lebensversicherungen gibt es oft garantierte Leistungen (z.B. eine Mindestverzinsung oder eine garantierte Rentenhöhe).
Unterschiede zwischen kapital- und fondsgebundener Lebensversicherung
Es gibt zwei Haupttypen von Lebensversicherungen, die sich hinsichtlich der Kapitalanlage und des Risikos unterscheiden:
Anlage: Die Beiträge werden hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren (Staatsanleihen, Hypothekenpapiere) und teilweise in Immobilien oder Aktien angelegt. Die Anlageentscheidung trifft die Versicherungsgesellschaft.
Garantien: Der Versicherer garantiert einen bestimmten Zinssatz auf den Sparanteil (Garantiezins). Zusätzlich erhalten Versicherungsnehmer eine Beteiligung an den Überschüssen, die die Versicherungsgesellschaft erzielt.
Risiko: Das Anlagerisiko trägt weitgehend die Versicherungsgesellschaft. Der Kunde hat ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich der späteren Auszahlung.
Renditepotenzial: Das Renditepotenzial ist aufgrund der Garantien und der konservativen Anlagestrategie in der Regel niedriger als bei fondsgebundenen Produkten, insbesondere in Phasen niedriger Zinsen.
Fondsgebundene Lebensversicherung (Unit-Linked)
Anlage: Die Beiträge (bzw. der Sparanteil nach Abzug der Kosten) werden in Investmentfonds investiert, die vom Versicherungsnehmer aus einer vorgegebenen Auswahl des Versicherers gewählt werden können (z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds).
Garantien: In der Regel gibt es keine Garantien auf den Wert der Anlage oder eine Mindestverzinsung. Die Wertentwicklung hängt direkt von der Entwicklung der ausgewählten Fonds ab. Es gibt jedoch auch Hybridmodelle mit Teilgarantien (z.B. Beitragsgarantie).
Risiko: Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kursrückgänge der Fonds können zu Verlusten führen und die Ablaufleistung schmälern.
Renditepotenzial: Das Renditepotenzial ist potenziell höher als bei klassischen Lebensversicherungen, da der Versicherungsnehmer an der Entwicklung der Kapitalmärkte partizipiert. Im Gegenzug ist das Risiko ebenfalls höher.
Probleme der Lebensversicherung als Altersvorsorge
Niedrigzinsphase: Klassische Lebensversicherungen haben in den letzten Jahren stark an Attraktivität verloren, da die Garantiezinsen aufgrund der extrem niedrigen Marktzinsen kaum noch über der Inflationsrate liegen. Dies kann zu einem realen Kaufkraftverlust führen.
Transparenz und Komplexität: Lebensversicherungsverträge sind oft komplex und schwer zu durchschauen, insbesondere in Bezug auf die Kostenstrukturen und die Verteilung der Überschüsse.
Geringe Flexibilität: Einmal abgeschlossene Verträge sind oft unflexibel. Eine vorzeitige Kündigung oder Beitragsfreistellung kann zu erheblichen Verlusten führen, da der Rückkaufswert, insbesondere in den ersten Jahren, oft deutlich unter den eingezahlten Beiträgen liegt.
Intransparente Kosten: Die Kostenstrukturen können intransparent sein und einen erheblichen Teil der anfänglichen Beiträge auffressen.
Abschlusskosten
Abschlusskosten sind ein wesentlicher Bestandteil der Kosten einer Lebensversicherung und werden oft als einer der größten Kritikpunkte genannt. Sie dienen der Deckung der Kosten für den Vertrieb und die Verwaltung des Vertrages.
Verrechnung: Abschlusskosten werden üblicherweise in den ersten Jahren des Vertrags vom Sparanteil der Beiträge abgezogen. Dies bedeutet, dass in den Anfangsjahren nur ein geringer Teil der eingezahlten Beiträge tatsächlich zur Kapitalanlage gelangt.
Höhe: Die Höhe der Abschlusskosten kann je nach Versicherungsgesellschaft und Vertriebsweg (z.B. Direktvertrieb, Makler, Bank) variieren. Sie werden oft als Prozentsatz der gesamten Beitragssumme über die Vertragslaufzeit berechnet.
Auswirkungen: Durch die hohen Abschlusskosten in den Anfangsjahren entsteht der sogenannte „Zillmer-Effekt“. Dieser bewirkt, dass der Rückkaufswert des Vertrages in den ersten Jahren sehr gering ist, da ein Großteil der Beiträge zur Deckung der Abschlusskosten verwendet wurde. Dies ist der Hauptgrund, warum sich eine vorzeitige Kündigung einer Lebensversicherung finanziell kaum lohnt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lebensversicherung als Altersvorsorge in den letzten Jahren durch die Niedrigzinsphase und gestiegene Anforderungen an Flexibilität und Transparenz an Attraktivität verloren hat. Während klassische Lebensversicherungen Sicherheit bei begrenztem Renditepotenzial bieten, ermöglichen fondsgebundene Verträge höhere Renditechancen bei gleichzeitig höherem Risiko. Unabhängig vom Typ sollten potenzielle Versicherungsnehmer die Kosten, insbesondere die Abschlusskosten, genau prüfen und die Langfristigkeit sowie die (In-)Flexibilität des Produkts in ihre Überlegungen einbeziehen.
Risikolebensversicherung
Risikolebensversicherung

Ihr Hauptzweck ist es, Hinterbliebene vor den finanziellen Folgen des unerwarteten Ablebens der versicherten Person zu schützen. Im Gegensatz zur kapitalbildenden Lebensversicherung dient sie nicht dem Vermögensaufbau, sondern ausschließlich der Risikoabsicherung. Tritt der Versicherungsfall (Tod) während der Vertragslaufzeit ein, wird die vereinbarte Versicherungssumme an die bezugsberechtigten Personen ausgezahlt. Andernfalls verfallen die gezahlten Beiträge.
Gegenstand der Risikolebensversicherung
Der Gegenstand der Risikolebensversicherung ist die Absicherung des Todesfallrisikos. Sie bietet finanzielle Sicherheit für:
Familien und Partner: Absicherung des Lebensunterhalts, der Ausbildung der Kinder oder der Finanzierung des Eigenheims.
Kreditnehmer: Absicherung von Darlehen (z.B. Baufinanzierungen), sodass im Todesfall die Restschuld beglichen werden kann und die Hinterbliebenen nicht mit den Schulden belastet werden.
Unternehmer und Geschäftspartner: Absicherung von Geschäftskrediten, Finanzierung von Abfindungen im Todesfall eines Partners oder zur Sicherstellung der Liquidität des Unternehmens.
Besonderheiten der Risikolebensversicherung
Reine Risikoabsicherung: Es wird kein Kapital aufgebaut und keine Überschussbeteiligung generiert, die über die vereinbarte Leistung hinausgeht. Dadurch sind die Beiträge im Vergleich zu kapitalbildenden Lebensversicherungen deutlich geringer.
Beitragszahlung und Leistung im Todesfall: Beiträge werden regelmäßig gezahlt. Die Leistung erfolgt nur im Todesfall innerhalb der Versicherungsdauer.
Laufzeit: Die Laufzeit wird individuell vereinbart und sollte dem Absicherungsbedarf entsprechen (z.B. bis zur Volljährigkeit der Kinder oder zur Tilgung eines Darlehens).
Begünstigtenregelung: Der Versicherungsnehmer kann frei bestimmen, wer im Todesfall die Leistung erhalten soll (z.B. Ehepartner, Kinder, Geschäftspartner).
Gesundheitsprüfung: Vor Vertragsabschluss ist in der Regel eine Gesundheitsprüfung erforderlich. Diese dient der Risikobewertung durch den Versicherer. Die Ergebnisse können zu Beitragszuschlägen, Leistungsausschlüssen oder auch zur Ablehnung des Antrags führen.
Modelle der Risikolebensversicherung am Markt
Am Markt existieren verschiedene Modelle, die sich in der Entwicklung der Versicherungssumme und der Beitragszahlung unterscheiden:
Konstante (gleichbleibende) Risikolebensversicherung:
Beschreibung: Die Versicherungssumme und in der Regel auch die Beiträge bleiben über die gesamte Vertragslaufzeit konstant.
Einsatzbereich: Ideal zur Absicherung des allgemeinen Lebensunterhalts von Familien oder für Darlehen, die nicht getilgt werden müssen (z.B. endfällige Darlehen).
Vorteil: Planungssicherheit durch gleichbleibende Leistungen und Beiträge.
Fallende (Annuitätische) Risikolebensversicherung:
Beschreibung: Die Versicherungssumme sinkt im Laufe der Zeit in vorher festgelegten Schritten oder linear. Die Beiträge bleiben in der Regel konstant oder sinken ebenfalls leicht.
Einsatzbereich: Besonders geeignet zur Absicherung von Darlehen mit Tilgungsplan (z.B. Baufinanzierungen), da sich die Versicherungssumme dem sinkenden Restschuldbetrag anpasst.
Vorteil: Geringere Beiträge als bei der konstanten RLV, da das Risiko für den Versicherer im Zeitverlauf abnimmt.
Linear fallende Risikolebensversicherung:
Beschreibung: Die Versicherungssumme reduziert sich jedes Jahr um einen festen Betrag, bis sie am Ende der Laufzeit null erreicht.
Einsatzbereich: Ebenfalls für Darlehensabsicherung geeignet, wenn die Tilgung annähernd linear erfolgt.
Beschreibung: Die Versicherungssumme sinkt in Anlehnung an den Verlauf einer Annuitätentilgung, d.h., der Betrag der Abnahme ist zu Beginn geringer und nimmt mit der Zeit zu.
Einsatzbereich: Speziell zugeschnitten auf die Absicherung von Annuitätendarlehen.
Verbundene Risikolebensversicherung (Kreuzversicherungen):
Beschreibung: Zwei Personen versichern sich gegenseitig in einem Vertrag. Stirbt eine der versicherten Personen, wird die vereinbarte Leistung an die andere Person ausgezahlt.
Einsatzbereich: Häufig bei Ehepaaren, Lebensgemeinschaften oder Geschäftspartnern.
Vorteil: Oftmals günstiger als zwei separate Einzelverträge. Es gibt jedoch auch Modelle, bei denen die Auszahlung nur einmal erfolgt, unabhängig davon, welche der beiden Personen zuerst verstirbt („Ableben des zuerst Versterbenden“). Hier sollte man genau auf die Vertragsdetails achten. Bei der sogenannten „Über-Kreuz-Versicherung“ sind die versicherten Personen gleichzeitig die Begünstigten des jeweils anderen, was steuerliche Vorteile bei der Erbschaftsteuer mit sich bringen kann.
Verkürzte Gesundheitsprüfungen für bestimmte Zielgruppen
Die Gesundheitsprüfung ist ein oft als Hürde empfundenes Element beim Abschluss einer Risikolebensversicherung. Um den Zugang für bestimmte Zielgruppen zu erleichtern, bieten einige Versicherer verkürzte Gesundheitsprüfungen oder vereinfachte Annahmeverfahren an. Dies ist insbesondere relevant für:
Jüngere Antragsteller (z.B. bis 35 oder 40 Jahre): Bei niedrigeren Versicherungssummen und in jungen Jahren ist das Risiko für den Versicherer statistisch geringer, sodass weniger detaillierte Angaben zum Gesundheitszustand erforderlich sind. Oftmals genügen hier wenige Ja/Nein-Fragen zu schwerwiegenden Vorerkrankungen.
Geringe Versicherungssummen: Bis zu einer bestimmten Versicherungssumme (z.B. 100.000 EUR oder 150.000 EUR) kann eine vereinfachte Gesundheitsprüfung angeboten werden.
Im Rahmen von Sonderaktionen oder Gruppenverträgen: Manchmal bieten Versicherer über bestimmte Vertriebskanäle oder für bestimmte Berufsgruppen (z.B. Ärzte, Beamte) vereinfachte Zugangsbedingungen an.
Angebot im Rahmen einer Baufinanzierung: Banken und Bausparkassen kooperieren oft mit Versicherern und bieten im Rahmen der Kreditabsicherung RLVs mit vereinfachter Gesundheitsprüfung an, da hier ein unmittelbarer Absicherungsbedarf besteht und die Versicherungssumme in der Regel dem Kreditbetrag entspricht.
Wichtige Hinweise zu verkürzten Gesundheitsprüfungen:
Potenziell höhere Beiträge: Die Vereinfachung der Gesundheitsprüfung kann unter Umständen zu leicht höheren Beiträgen führen, da der Versicherer ein potenziell höheres Risiko (aufgrund weniger detaillierter Informationen) pauschal einkalkulieren muss.
Eingeschränkte Leistungen oder Ausschlüsse: Es ist wichtig, die Vertragsbedingungen genau zu prüfen. Unter Umständen können bei vereinfachter Prüfung bestimmte Vorerkrankungen von der Leistung ausgeschlossen sein, die bei einer detaillierten Prüfung ggf. mit einem Risikozuschlag versicherbar gewesen wären.
Wahrheitsgemäße Angaben sind Pflicht: Auch bei verkürzten Prüfungen müssen die gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet werden. Falsche oder unvollständige Angaben können im Leistungsfall zur Verweigerung der Zahlung durch den Versicherer führen.
Insgesamt ist die Risikolebensversicherung ein unverzichtbares Instrument zur finanziellen Absicherung im Todesfall. Die Wahl des richtigen Modells hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und der jeweiligen Lebenssituation ab. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und sich gegebenenfalls von einem unabhängigen Versicherungsexperten beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden und die Besonderheiten der Gesundheitsprüfung zu berücksichtigen.
Dread-Desease-Versicherung
Dread-Desease-Versicherung

Sie unterscheidet sich damit grundlegend von anderen Versicherungen wie der Berufsunfähigkeitsversicherung oder der Krankenversicherung.
Gegenstand und Besonderheiten der Dread-Disease-Versicherung
Gegenstand:
Der Hauptgegenstand der Dread-Disease-Versicherung ist der Schutz vor den finanziellen Folgen einer schweren Erkrankung. Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsversicherung, die leistet, wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, oder der Krankenversicherung, die Behandlungskosten übernimmt, zahlt die Dread-Disease-Versicherung einen vorher festgelegten Kapitalbetrag aus, sobald eine spezifische schwere Krankheit diagnostiziert wird, unabhängig davon, ob dies zu einer Berufsunfähigkeit führt oder wie hoch die tatsächlichen Krankheitskosten sind.
Besonderheiten
Einmalige Kapitalleistung: Dies ist das zentrale Merkmal. Die Auszahlung erfolgt als einmaliger Betrag, der frei verwendet werden kann. Er dient dazu, finanzielle Engpässe zu überbrücken, Arztkosten zu decken, Umbauten im Haus zu finanzieren, den Lebensstandard zu sichern oder sich teure Spezialbehandlungen leisten zu können.
Katalog von Krankheiten: Die Versicherungspolice listet einen genauen Katalog von schweren Krankheiten auf, die versichert sind. Typische Beispiele sind:
- Krebs (in verschiedenen Formen und Schweregraden)
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Nierenversagen
- Multiple Sklerose
- Organtransplantationen
- Komplette Erblindung oder Taubheit
- Fortgeschrittene Alzheimer- oder Parkinson-Krankheit
Querschnittslähmung Der genaue Umfang und die Definition der Krankheiten variieren stark zwischen den Anbietern.
Definitionen und Schweregrade: Die Bedingungen für die Auszahlung sind oft sehr präzise formuliert und beziehen sich auf bestimmte Schweregrade oder Diagnosen. Ein „Herzinfarkt“ ist beispielsweise erst dann versichert, wenn bestimmte medizinische Kriterien (z.B. Erhöhung spezifischer Enzyme) erfüllt sind.
Keine Gesundheitsprüfung bei Antragsstellung: Wie bei anderen Risikoversicherungen ist auch hier eine ausführliche Gesundheitsprüfung notwendig. Vorerkrankungen oder Risikofaktoren können zu Ausschlüssen, Risikozuschlägen oder einer Ablehnung des Antrags führen.
Unabhängigkeit von Berufsunfähigkeit: Die Dread-Disease-Versicherung zahlt auch dann, wenn die schwere Krankheit nicht zu einer Berufsunfähigkeit führt. Dies ist ein wichtiger Unterschied zur Berufsunfähigkeitsversicherung.
Einfachheit der Leistungsabwicklung: Im Vergleich zur Berufsunfähigkeitsversicherung, bei der oft langwierige Prüfungen der Berufsunfähigkeit notwendig sind, ist die Leistungsabwicklung bei der Dread-Disease-Versicherung oft einfacher, da es lediglich um die Bestätigung der Diagnose einer im Vertrag genannten Krankheit geht.
Ergänzung zu bestehenden Versicherungen: Sie ist keine Alternative, sondern eine Ergänzung zur Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung.
Wann und unter welchen Umständen geleistet wird
Die Leistungspflicht der Dread-Disease-Versicherung tritt ein, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Diagnose einer versicherten Krankheit: Eine der im Vertrag explizit genannten schweren Krankheiten muss von einem qualifizierten Arzt (oft ist ein Facharzt vorgeschrieben) eindeutig diagnostiziert werden.
Erfüllung der vertraglichen Definitionen: Die Diagnose muss den genauen Definitionen und Kriterien entsprechen, die im Versicherungsvertrag festgelegt sind. Dazu können bestimmte Schweregrade, Zeiträume oder medizinische Befunde gehören.
Beispiel: Bei Krebs kann es eine Wartezeit geben, in der die Krankheit noch nicht versichert ist, oder es sind bestimmte histologische Befunde notwendig. Bei einem Herzinfarkt muss oft eine bestimmte Erhöhung von Biomarkern im Blut nachgewiesen werden.
Überleben einer bestimmten Frist (Survival Period): Die meisten Verträge enthalten eine sogenannte „Survival Period“ (Überlebensfrist), die in der Regel 14 bis 30 Tage beträgt. Das bedeutet, dass der Versicherungsnehmer die Diagnose der schweren Krankheit um diese Frist überleben muss, damit die Leistung ausgezahlt wird. Stirbt die versicherte Person innerhalb dieser Frist nach der Diagnose, entfällt in der Regel der Leistungsanspruch. Diese Klausel soll verhindern, dass die Versicherung als eine Art Todesfallversicherung im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Krankheit missbraucht wird.
Keine Ausschlüsse: Die Krankheit darf nicht auf einen im Vertrag genannten Ausschlussgrund zurückzuführen sein (z.B. Selbstverletzung, Kriegsereignisse, bestimmte gefährliche Hobbys, Krankheiten, die bereits vor Versicherungsbeginn bestanden und nicht angegeben wurden).
Meldung an den Versicherer: Die Diagnose der schweren Krankheit muss dem Versicherer zeitnah und gemäß den vertraglichen Bestimmungen gemeldet werden. Es sind in der Regel ärztliche Atteste und Befunde einzureichen.
Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, zahlt der Versicherer die im Vertrag vereinbarte Kapitalleistung aus.
Steuerliche Behandlung in der Beitrags- und Auszahlungsphase
Die steuerliche Behandlung der Dread-Disease-Versicherung in Deutschland ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere davon, ob sie als eigenständiger Vertrag oder als Zusatzbaustein zu einer anderen Versicherung (z.B. Risikolebensversicherung) abgeschlossen wurde und wie sie rechtlich ausgestaltet ist.
Beitragsphase:
Grundsätzlich sind die Beiträge zur Dread-Disease-Versicherung nicht als Sonderausgaben abzugsfähig. Sie fallen nicht unter die typischen Vorsorgeaufwendungen wie Beiträge zur Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung, die im Rahmen der Höchstbeträge steuerlich geltend gemacht werden können.
Es gibt jedoch eine Ausnahme, wenn die Dread-Disease-Versicherung als Zusatzbaustein zu einer kapitalgedeckten Lebensversicherung oder einer privaten Rentenversicherung abgeschlossen wird. In diesem Fall können die Beiträge unter Umständen gemeinsam mit den Beiträgen der Hauptversicherung im Rahmen der Höchstbeträge für sonstige Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) geltend gemacht werden. Allerdings ist der Anteil der Dread-Disease-Komponente oft gering und der abzugsfähige Höchstbetrag für Vorsorgeaufwendungen schnell ausgeschöpft, insbesondere wenn bereits Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden.
Die Besteuerung der Kapitalleistung aus der Dread-Disease-Versicherung hängt davon ab, wie der Vertrag rechtlich qualifiziert wird:
Als eigenständige Risikoversicherung:
Wird die Dread-Disease-Versicherung als reine Risikoversicherung (wie eine Risikolebensversicherung auf den Todesfall) abgeschlossen, ist die Auszahlung bei Eintritt des Versicherungsfalls in der Regel steuerfrei nach § 3 Nr. 1 EStG. Dies gilt, wenn die Versicherung ausschließlich der Absicherung biometrischer Risiken (wie Krankheit) dient und keine Kapitalanlagekomponente enthält.
Die Prämisse hier ist, dass es sich um eine „echte“ Risikoversicherung handelt, bei der die Leistung nicht an die Erlebbarkeit des Ablaufs gekoppelt ist oder keine Rückkaufswerte gebildet werden.
Als Zusatzbaustein zu einer kapitalbildenden Lebens- oder Rentenversicherung:
Wenn die Dread-Disease-Versicherung als Zusatzbaustein zu einer kapitalbildenden Lebensversicherung oder einer privaten Rentenversicherung abgeschlossen wurde, kann die Auszahlung komplexer sein.
Handelt es sich um eine Auszahlung wegen einer versicherten schweren Krankheit, die im Todesfall des Versicherungsnehmers auch als Todesfallleistung gezahlt worden wäre, so ist die Leistung ebenfalls steuerfrei gemäß § 3 Nr. 1 EStG. Das ist die gängige Auslegung. Die Dread-Disease-Leistung wird hier funktional einer Todesfallleistung gleichgestellt.
In seltenen Fällen, wenn die Dread-Disease-Leistung als eine Art „vorgezogene“ Leistung aus dem Kapitalstock einer Lebensversicherung interpretiert werden könnte, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem biometrischen Risiko steht (was aber unüblich ist), könnte eine Besteuerung nach den Regeln für Kapitalerträge (§ 20 EStG) in Betracht kommen. Dies wäre dann der Fall, wenn die Versicherung eigentlich auf Erleben abgeschlossen wurde und die Dread-Disease-Leistung als vorzeitiger Erlebensfall betrachtet wird. Dies ist bei der üblichen Ausgestaltung der Dread-Disease-Versicherung jedoch nicht der Fall.
Die steuerliche Beurteilung kann im Einzelfall komplex sein und hängt von der genauen vertraglichen Ausgestaltung sowie der jeweils aktuellen Rechtsprechung ab. Es ist ratsam, bei Abschluss einer solchen Versicherung und insbesondere bei einer möglichen Auszahlung einen Steuerberater zu konsultieren, um die individuelle Situation korrekt zu bewerten und mögliche steuerliche Fallstricke zu vermeiden.
Zusammenfassend bietet die Dread-Disease-Versicherung eine wichtige finanzielle Absicherung bei schweren Krankheiten, die es ermöglicht, sich voll auf die Genesung zu konzentrieren, ohne sich um finanzielle Sorgen kümmern zu müssen. Ihre Besonderheit liegt in der einmaligen Kapitalauszahlung bei Diagnose einer vertraglich definierten Krankheit, unabhängig von Berufsunfähigkeit oder tatsächlichen Behandlungskosten. Steuerlich sind die Beiträge in der Regel nicht abzugsfähig, die Auszahlungen meist steuerfrei.
Grundfähigkeitenversicherung
Grundfähigkeitenversicherung

Sie bietet finanziellen Schutz, wenn elementare körperliche oder geistige Fähigkeiten verloren gehen.
Gegenstand und Besonderheiten der Grundfähigkeitenversicherung
Gegenstand: Die GFV versichert den Verlust spezifischer, im Versicherungsvertrag definierter Grundfähigkeiten. Dazu gehören typischerweise:
Motorische Fähigkeiten: Gehen, Stehen, Treppensteigen, Bücken, Knien, Heben, Tragen, Arme und Hände gebrauchen (Greifen, Halten, Tragen).
Sensorische Fähigkeiten: Sehen, Hören, Sprechen.
Intellektuelle/Kognitive Fähigkeiten: Orientierungssinn, Gedächtnis, Urteilsfähigkeit (oft als „geistige Leistungsfähigkeit“ oder „Denken“ umschrieben).
Weitere grundlegende Verrichtungen: Essen, Trinken, An- und Ausziehen, die Kontrolle von Blase und Darm.
Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) wird hier nicht primär auf die Unfähigkeit, den zuletzt ausgeübten Beruf auszuüben, abgestellt, sondern auf den Verlust einer oder mehrerer definierter Grundfähigkeiten, unabhängig vom konkreten Beruf des Versicherten.
Fokus auf den Fähigkeitsverlust: Der Leistungsfall tritt ein, wenn eine oder mehrere der versicherten Grundfähigkeiten in einem im Vertrag definierten Maße (z.B. für einen bestimmten Zeitraum) verloren gehen. Dies ist der wesentliche Unterschied zur BU, die auf die abstrakte oder konkrete Berufsunfähigkeit abstellt.
Weniger komplexe Leistungsprüfung: Da nicht die konkrete Berufstätigkeit bewertet werden muss, kann die Leistungsprüfung bei der GFV tendenziell einfacher und schneller sein. Es geht darum, objektiv den Verlust der Fähigkeit festzustellen.
Zugänglichkeit für bestimmte Berufsgruppen: Für Berufe mit hohem körperlichem Risiko oder für Personen mit Vorerkrankungen, die den Abschluss einer BU erschweren oder verteuern würden, kann die GFV eine gute Alternative sein, da die Gesundheitsprüfung hier oftmals weniger streng ausfällt oder sich auf spezifische Fähigkeiten konzentriert.
Kombinierbarkeit: Die GFV kann eine Ergänzung zur BU sein oder eine eigenständige Absicherung darstellen, wenn eine BU nicht möglich oder gewünscht ist.
Klare Definition der Fähigkeiten: Die versicherten Fähigkeiten sind im Vertrag präzise definiert, was zu einer hohen Transparenz über den Umfang des Versicherungsschutzes führt.
Wann und unter welchen Umständen geleistet wird
Leistungen aus der Grundfähigkeitenversicherung werden erbracht, wenn der Versicherte eine oder mehrere der im Vertrag explizit genannten Grundfähigkeiten vollständig und voraussichtlich dauerhaft verliert oder diese nur noch unter ganz bestimmten, im Vertrag definierten Einschränkungen ausüben kann.
Konkrete Umstände für die Leistungspflicht:
Verlust der Fähigkeit: Der Versicherte ist beispielsweise nicht mehr in der Lage, zu gehen, sich an- und auszuziehen, zu sehen oder zu sprechen. Die genaue Definition des Verlusts (z.B. „nicht in der Lage, eine bestimmte Strecke zu gehen“ oder „nicht in der Lage, die Toilette ohne fremde Hilfe zu benutzen“) ist entscheidend und variiert je nach Versicherer.
Dauerhaftigkeit: Oftmals ist ein prognostizierter Zeitraum für den Verlust der Fähigkeit erforderlich (z.B. voraussichtlich für mindestens 6 Monate). Einige Verträge sehen auch eine Leistung vor, wenn die Fähigkeit für einen kürzeren, aber erheblichen Zeitraum verloren geht.
Ärztliche Feststellung: Der Verlust der Grundfähigkeit muss in der Regel ärztlich attestiert und dokumentiert werden.
Unabhängigkeit von der Ursache: In der Regel ist es unerheblich, ob der Verlust der Fähigkeit durch Krankheit, Unfall oder altersbedingte Abnutzung (sofern nicht explizit ausgeschlossen) eingetreten ist.
Einhaltung der Wartezeit: Viele Verträge beinhalten eine Wartezeit nach Vertragsabschluss, innerhalb derer noch keine Leistungen erbracht werden.
Leistung:
Im Leistungsfall wird in der Regel eine vereinbarte monatliche Rente ausgezahlt. Die Höhe der Rente wird bei Vertragsabschluss festgelegt und sollte ausreichen, um den finanziellen Bedarf des Versicherten zu decken (z.B. Einkommensausfall, Kosten für Assistenz oder Hilfsmittel).
Steuerliche Behandlung in der Beitrags- und Auszahlungsphase
Die steuerliche Behandlung der Grundfähigkeitenversicherung ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt werden sollte.
Beitragsphase:
Nicht abzugsfähig: Die Beiträge zur Grundfähigkeitenversicherung können nicht als Sonderausgaben in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Sie fallen weder unter die Vorsorgeaufwendungen im engeren Sinne noch unter die sonstigen Versicherungsbeiträge, die abzugsfähig wären (z.B. Beiträge zur Riester-Rente oder Rürup-Rente).
Hintergrund: Da die GFV primär eine Absicherung gegen den Verlust von Fähigkeiten und nicht eine Altersvorsorge darstellt, sind die Beiträge steuerlich nicht begünstigt.
Auszahlungsphase:
Besteuerung mit dem Ertragsanteil: Die Rentenzahlungen aus einer Grundfähigkeitenversicherung werden nicht in voller Höhe besteuert, sondern lediglich mit dem sogenannten Ertragsanteil.
Ertragsanteil: Der Ertragsanteil ist ein fester Prozentsatz der Rente, der sich nach dem Alter des Versicherten bei Rentenbeginn richtet (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG). Je jünger der Versicherte bei Rentenbeginn ist, desto höher ist der Ertragsanteil, da statistisch von einer längeren Rentenbezugsdauer ausgegangen wird.
Beispiel: Beginnt die Rente mit 50 Jahren, liegt der Ertragsanteil bei ca. 30%. Bei einem Rentenbeginn mit 60 Jahren liegt er bei ca. 22%.
Hintergrund: Die Besteuerung des Ertragsanteils soll den „Ertrag“ aus den eingezahlten Beiträgen widerspiegeln, da die Beiträge in der Ansparphase nicht steuerlich abzugsfähig waren. Es handelt sich um eine Form der nachgelagerten Besteuerung, die ähnlich wie bei privaten Rentenversicherungen angewendet wird.
Ausnahme – teilweise steuerfrei bei bestimmten Policen: Es gibt spezielle Ausgestaltungen der Grundfähigkeitenversicherung, die als „andere Leistungen aus Kapitallebens- und Rentenversicherungen“ nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG gelten könnten. Hier würde bei einer Rentenzahlung der Ertragsanteil besteuert. Ist die GFV jedoch explizit als Versicherung gegen den Verlust von Grundfähigkeiten konzipiert und nicht als Altersvorsorgeprodukt, ist die Besteuerung des Ertragsanteils der Regelfall.
Wichtig: Es ist ratsam, im individuellen Fall die genaue steuerliche Behandlung mit einem Steuerberater zu klären, da die Ausgestaltung der Verträge und die aktuelle Rechtslage Einfluss auf die Besteuerung haben können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grundfähigkeitenversicherung eine wertvolle Absicherung darstellt, die gezielt den Verlust elementarer Fähigkeiten abdeckt. Ihre Stärken liegen in der klar definierten Leistungsprüfung und der potenziell einfacheren Zugänglichkeit für bestimmte Personenkreise. Die Beiträge sind nicht steuerlich absetzbar, die Leistungen werden jedoch lediglich mit dem Ertragsanteil besteuert.
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung

Sie bietet finanziellen Schutz, wenn man seinen zuletzt ausgeübten Beruf aufgrund von Krankheit, Körperverletzung oder altersentsprechendem Kräfteverfall nicht mehr ausüben kann.
Gegenstand und Besonderheiten der Berufsunfähigkeitsversicherung
Gegenstand: Die BU-Versicherung zahlt eine monatliche Rente, wenn der Versicherte berufsunfähig wird. Ziel ist es, den Einkommensverlust auszugleichen und so den Lebensstandard zu sichern. Die Berufsunfähigkeit wird in der Regel definiert als die dauerhafte Unfähigkeit, seinen zuletzt ausgeübten Beruf zu einem bestimmten Prozentsatz (meist 50%) auszuüben.
Abstrakte Verweisung: Ein zentrales Merkmal und eine wichtige Unterscheidung zu älteren oder einfacheren Formen der Arbeitskraftabsicherung ist der Verzicht auf die „abstrakte Verweisung“. Das bedeutet, der Versicherer kann den Versicherten nicht auf einen anderen, theoretisch möglichen, aber nicht tatsächlich ausgeübten Beruf verweisen, den er noch ausüben könnte. Kann der Versicherte seinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben, ist er berufsunfähig, auch wenn er theoretisch noch eine andere Tätigkeit ausüben könnte.
Konkrete Verweisung: Die „konkrete Verweisung“ ist jedoch in den meisten Tarifen enthalten. Hierbei kann der Versicherer auf eine tatsächlich ausgeübte, neue Tätigkeit verweisen, wenn diese der bisherigen Lebensstellung (Einkommen, soziale Wertschätzung) entspricht. Dies kommt in der Praxis jedoch seltener vor und ist an strenge Kriterien gebunden.
Nachprüfung und Leistungsdauer: Die BU-Rente wird in der Regel zunächst befristet gezahlt, oft für drei Jahre. Danach erfolgt eine Nachprüfung, ob die Berufsunfähigkeit weiterhin besteht. Die Rente kann bis zum Eintritt ins Rentenalter gezahlt werden, wenn die Berufsunfähigkeit fortbesteht.
Verzicht auf Arztanordnungsklausel: Moderne BU-Verträge verzichten oft auf die sogenannte „Arztanordnungsklausel“. Diese besagte, dass der Versicherte sich ärztlichen Behandlungen unterziehen muss, um die Berufsunfähigkeit zu beenden. Ein Verzicht darauf bedeutet mehr Autonomie für den Versicherten.
Wichtigkeit der Gesundheitsprüfung: Vor Vertragsabschluss ist eine umfassende Gesundheitsprüfung erforderlich. Ungenaue oder falsche Angaben können im Leistungsfall zu Problemen führen, bis hin zur Leistungsablehnung.
Anpassungsmöglichkeiten: Viele Verträge bieten Dynamikoptionen (jährliche Erhöhung der Beiträge und Leistungen), Erhöhungsoptionen (bei bestimmten Lebensereignissen wie Heirat, Geburt, Gehaltserhöhung) und die Möglichkeit, die Laufzeit anzupassen.
Wann und unter welchen Umständen geleistet wird
Leistungen werden erbracht, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, d.h. wenn der Versicherte berufsunfähig ist. Die genauen Voraussetzungen sind in den Versicherungsbedingungen (AVB) festgelegt, aber im Allgemeinen gilt:
Definition der Berufsunfähigkeit: Der Versicherte muss seinen zuletzt ausgeübten Beruf (oder eine gleichwertige Tätigkeit, falls eine konkrete Verweisung greift) aufgrund von Krankheit, Körperverletzung oder altersentsprechendem Kräfteverfall nicht mehr ausüben können.
Prozentsatz: Die Berufsunfähigkeit muss in der Regel zu mindestens 50% vorliegen. Das bedeutet, der Versicherte kann die Hälfte seiner bisherigen Tätigkeit nicht mehr ausüben.
Dauerhaftigkeit: Die Berufsunfähigkeit muss voraussichtlich für einen bestimmten Zeitraum (oft 6 Monate) dauerhaft bestehen oder bestanden haben.
Meldung und Nachweise: Der Versicherte muss die Berufsunfähigkeit dem Versicherer melden und entsprechende ärztliche Atteste und Gutachten vorlegen. Der Versicherer prüft den Fall sorgfältig.
Rückwirkende Leistung: Oft wird die Leistung rückwirkend ab dem Zeitpunkt der eingetretenen Berufsunfähigkeit erbracht, sofern diese innerhalb einer bestimmten Frist gemeldet wurde.
Steuerliche Behandlung in der Beitrags- und Auszahlungsphase
Rürup-Basisrente (Schicht 1): Wird die BU-Versicherung als Zusatzbaustein zu einer Rürup-Rente abgeschlossen, können die Beiträge zur BU-Versicherung als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Die Absetzbarkeit richtet sich nach dem Höchstbetrag für Altersvorsorgeaufwendungen und steigt jährlich an. Im Jahr 2025 können 100% der Beiträge (bis zum Höchstbetrag) abgesetzt werden.
Privat abgeschlossene BU-Versicherung (Schicht 3): Die Beiträge für eine „reine“ private BU-Versicherung, die nicht als Zusatzbaustein zu einer Rürup- oder Riester-Rente abgeschlossen wird, sind in der Regel nicht gesondert als Sonderausgaben absetzbar. Sie fallen unter die sonstigen Vorsorgeaufwendungen, bei denen es jedoch sehr niedrige Pauschbeträge gibt, die in der Regel bereits durch andere Versicherungen (Kranken-, Pflegeversicherung) ausgeschöpft sind.
Rürup-Basisrente (Schicht 1): Die Leistungen aus einer BU-Versicherung, die als Zusatzbaustein zu einer Rürup-Rente gezahlt werden, sind als „sonstige Einkünfte“ voll steuerpflichtig. Der Besteuerungsanteil richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns und dem Alter des Rentenbeziehers. Er steigt jährlich an.
Privat abgeschlossene BU-Versicherung (Schicht 3): Die Leistungen aus einer privaten BU-Versicherung sind nach dem sogenannten Ertragsanteil steuerpflichtig. Der Ertragsanteil ist ein geringer Prozentsatz der Rente und richtet sich nach der voraussichtlichen Laufzeit der Rente oder dem Alter bei Rentenbeginn. Je länger die voraussichtliche Rentenlaufzeit, desto höher der Ertragsanteil. Bei einer lebenslangen Rente ist der Ertragsanteil höher als bei einer befristeten Rente. Dies ist ein erheblicher Steuervorteil im Vergleich zu Leistungen aus der Rürup-Rente.
Unterschiede zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Die Begriffe Berufsunfähigkeit (BU) und Erwerbsunfähigkeit (EU) werden oft verwechselt, bezeichnen aber unterschiedliche Sachverhalte und Absicherungslevel:
| Merkmal | Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) | Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU) |
| Bezugspunkt | Zuletzt ausgeübter Beruf | Allgemeiner Arbeitsmarkt |
| Definition | Unfähigkeit, den zuletzt ausgeübten Beruf zu einem bestimmten Prozentsatz (meist 50%) auszuüben. | Unfähigkeit, irgendeiner regelmäßigen Erwerbstätigkeit (mind. 3 Stunden täglich) nachzugehen. |
| Abstrakte Verweisung | In modernen Verträgen in der Regel ausgeschlossen. | Bestandteil der Definition: Es wird geprüft, ob der Versicherte noch irgendeine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben könnte. |
| Leistungsvoraussetzung | Deutlich einfacher zu erfüllen, da nur der zuletzt ausgeübte Beruf betrachtet wird. | Deutlich schwieriger zu erfüllen, da auch eine Tätigkeit unterhalb des bisherigen Berufsstandards zu einer Ablehnung führen kann. |
| Schutzumfang | Bietet einen wesentlich umfassenderen Schutz der individuellen Arbeitskraft und des bisherigen Lebensstandards. | Bietet einen Basisschutz und greift erst, wenn der Versicherte gar keine nennenswerte Erwerbstätigkeit mehr ausüben kann. |
| Anbieter | Ausschließlich private Versicherungsunternehmen. | Wurde in dieser Form von der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2000 angeboten; heute: Erwerbsminderungsrente als Leistung der Deutschen Rentenversicherung. |
| Heutige Relevanz | Die wichtigste private Absicherung der Arbeitskraft. | Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente ist ein wichtiges Fundament, aber oft nicht ausreichend zur Existenzsicherung. |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung einen maßgeschneiderten Schutz bietet, der sich am individuellen Beruf und dem damit verbundenen Lebensstandard orientiert. Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (bzw. die heutige Erwerbsminderungsrente) ist hingegen eine Grundabsicherung, die erst greift, wenn man keinerlei nennenswerter Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann. Für die meisten Berufstätigen ist eine private Berufsunfähigkeitsversicherung daher unverzichtbar, um im Falle einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können.